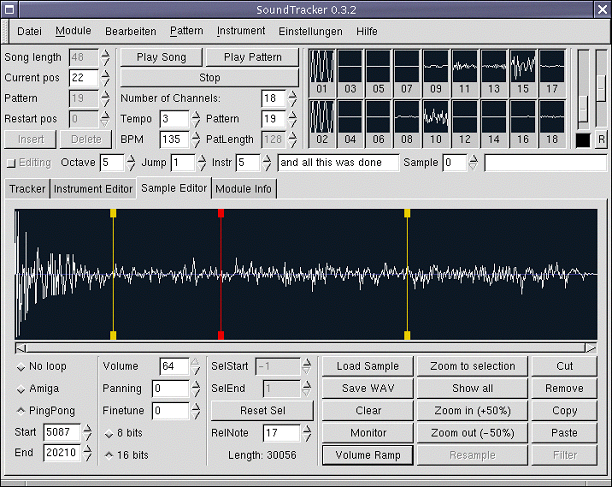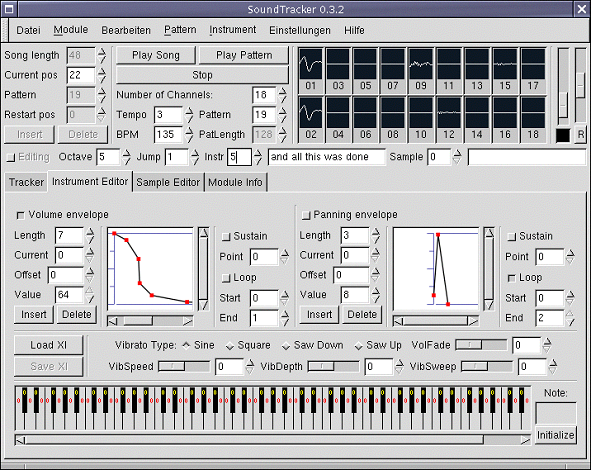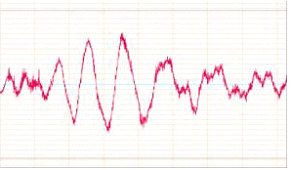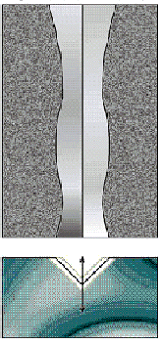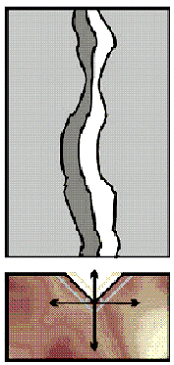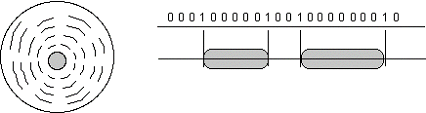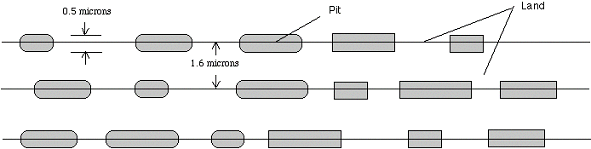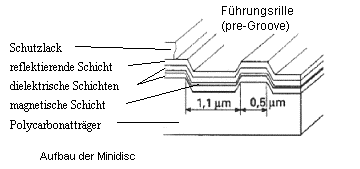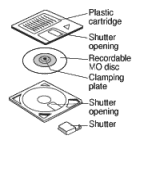|
Allgemeines
Es werden die Audioformate wav, midi, mod und- wie koennte es anders sein-
mp3 verglichen. Man kann diese vier Formate prinzipiell in 2 Gruppen
einteilen: wav und mp3 auf der einen und mod und midi auf der anderen Seite.
Bei wav werden die gesamten Audiodaten in einzelnen Samples gespeichert; mp3
komprimiert diese Audiodaten ohne spürbaren Qualitätsverlust, wobei man mit
einem Bruchteil des ursprünglichen Speicherbedarfs auskommt.
Mod-files verwenden ein ganz anderes Prinzip: Statt das Musikstück in
einzelne Samples zu zerlegen, werden hier die Samples der Instrumente
abgespeichert. MIDI funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise.
WAV
technisch
WAV ist ein sogenanntes chunkformat: Es besteht aus einer Reihe sogenannter
chunks, welche die gesamte Information über das Audio-Stück beinhalten. Dabei
kann man zunächst zwischen notwendigen und optionalen chunks unterscheiden.
Es gibt 3 chunks, welche in jedem WAV-file enthalten sein müssen. Dies sind
der Form-, der FMT- und der Data- Chunk. Diese 3 Chunks bilden das
Grundgerüst des files. Alle weiteren Chunks, wie z.B. der Playlist-Chunk,
sind optional.
WAV-files sind im Allgemeinen unkomprimiert. Abhängig von der Abtastrate und
davon, ob das signal monoform oder stereoform vorliegt und ob 8 oder 16 bit
für jeden Abtastwert verwendet werden, kann eine Aufzeichnung von einer
Minute Dauer zwischen 644 KB und 10 MB Speicher benötigen.
Auf CDs werden Daten im sog. CD-DA Format gespeichert, welches dem Standard
WAV-Format sehr ähnlich ist.
historisch
Das WAV-Format ist ein Subset von Microsoft's RIFF-Spezifikation und kann
verschiedenste Arten von Daten enthalten. Ursprünglich war es für
Multimedia-Files vorgesehen, doch die Spezifikation ist relativ offen (also
nicht besonders strikt) und erlaubt es, praktisch alles in einem solchen file
zu plazieren; ungeeignete Daten würden von einem Programm, welches das Format
korrekt interpretiert, einfach ignoriert.
RIFF ist ein Format für Multimedia-Daten wie Audio und Video, es basiert auf
sog. Chunks und Sub-Chunks. Das gesamte RIFF-File ist wiederum ein Chunk, der
alle anderen Chunks enthält.
WAVE (WAV) ist ein Subtyp von RIFF und muss aus mindestens 3 Chunks bestehen,
alle weitere RIFF-Chunks sind außerdem zulässig. Da eine einfachere
(unvollständige) Version des WAVE-Formats vor der Win32 API veröffentlicht
wurde, haben ältere Programme unter Umständen Probleme, WAVEs zu
interpretieren, welche aus mehr als 3 Chunks bestehen.
Es ist eine relativ unbekannte Tatsache, dass WAVE-files Datenkompression
unterstützen. Tatsächlich sind komprimierte WAVE-files relativ unüblich. Die
Win32 API Dokumentation gibt Aufschluss darüber, welche Kompressionen möglich
sind und wie komprimiert / dekomprimiert wird.
Anwendung
Im Prinzip für alle Gelegenheiten geeignet, aber normalerweise
(unkomprimiert) erzeugt WAV (bei hoher bzw. CD-Qualität) sehr große Dateien.
Aufnahme und Wiedergabe sind problemlos. Verwendung bei:
- Qualitätsmässig
hochwertigen aber kleinen Tondateien
- Sprachaufnahmen in
mono
- Einfachen
Musikaufnahmen
- Eingeschränkten
Aufnahmemöglichkeiten.
Zusätzlich ist WAV meist das Zwischenformat
zwischen MP3 und CDDA: Wenn man ein mp3 von Songs auf einer CD erzeugen will,
erzeugt man erst die WAVs von den Tracks auf der CD und komprimiert diese
dann zu mp3s. Umgekehrt werden oft mp3s zu WAVs dekomprimiert und dann als
CDDA auf CD gebrannt. Die Konvertierung WAV -> CDDA übernimmt dabei die
CD-R-Software.
MP3
technisch
MP3 steht für MPEG Layer III. Vereinfacht kann man mp3's als komprimierte
wav-files betrachten. Generell kann man sagen, dass ein "typisches"
mp3 1/10 des Speicherplatzes des korrespondierenden unkomprimierten
audio-formats benötigt.
Unkomprimierte Audiodaten, wie z.B. auf einer Audio-CD, speichern mehr Daten
als das menschliche Ohr verarbeiten kann. Wenn zwei Noten sich sehr ähnlich
sind und sehr nahe beieinander liegen, wird das menschliche Ohr nur eine der
beiden Noten hören. Wenn zwei Sounds sehr unterschiedlich sind, jedoch einer
sehr viel lauter als der andere ist, hört das menschliche Ohr nur den
lauteren Sound. Außerdem ist das menschliche Ohr für gewisse Frequenzen
empfänglicher als für andere. Die Studie dieser Phänomene nennt man
Psychoakustik, und darüber ist sehr viel bekannt. Diese Phänomene sind
genauestens in Tabellen, Diagrammen und mathematischen Modellen des
menschlichen Hörprozesses zusammengefasst. Sehr vereinfacht gesagt liest ein
mp3 encoder also ein wav-file und lässt all jene Daten weg, die das
menschliche Ohr sowieso nicht hören würde.
Mp3 wird auch als "perceptual codec" bezeichnet. Ein
"Codec" ist ein Satz von Kompressions- und Dekompressionsalgorithmen.
Mit "perceptual" ist gemeint, dass es wenig Sinn hat, Information
zu speichern, welches Menschen sowieso nicht hören können. Wie einfach sich
dies auch anhören mag- man ist überrascht, erfährt man, dass gute Aufnahmen
eine Unmenge an Daten speichern, welche man nie hören wird, weil das
recording equipment (Mikrophone, Gitarren, etc.) für ein breiteres Spektrum
von Sounds und Audioauflösungen empfänglich ist.
Mp3 verwendet zwei Kompressionsverfahren, um diese Kompressionsraten über
unkomprimierte Audiodaten zu erzielen. Im ersten Schritt wird verworfen, was
wir nicht hören (bzw. akzeptable Kompromisse gemacht); im zweiten Schritt
werden Redundanzen mit herkömmlicheren Algorithmen weiter komprimiert. Der
erste Schritt ist bei weitem komplizierter und komplexer als der zweite.
- Signal wird in
Frames aufgespaltet (typische Länge: Bruchteil einer Sekunde).
- Signal analysieren:
Auf dem gesamten Spektrum der hörbaren Frequenzen, herausfinden, wie die
bits verteilt werden müssen, um die Audiodaten optimal zu komprimieren.
Da verschiedene Frequenzbereiche am besten mit ähnlichen Algorithmen
behandelt werden, wird das Signal hier in sub-banden eingeteilt, welche
parallel verarbeitet werden können.
- Aus der angegebenen
Bitrate wird berechnet, wieviele bits auf ein Frame fallen. Mit 128 kbps
gibt es z.B. eine Obergrenze, welche angibt, wie viele Daten in einem
Frame gespeichert werden können (außer, man arbeitet mit Variablen
Bitraten (VBR)). Dieser Schritt entscheidet, wieviel der vorhandenen
Audiodaten gespeichert werden und wieviel davon verworfen wird.
- Die Frequenzen,
welche jedes Frame belegen, werden mit mathematischen Modellen der
Psychoakustik verglichen, welche im Codec als Referenztabelle
gespeichert sind. Aus dem Modell kann abgeleitet werden, welche Frequenzen
genauestens erfasst werden müssen und welche weggelassen werden können
bzw. nur wenige bits in Anspruch nehmen dürfen, da der Mensch sie
sowieso nicht hören kann.
- Auf den erhaltene
Bitstream wird der Prozess des Huffman-Coding angewendet, welcher
redundante Information komprimiert. Huffman-Coding arbeitet nicht mit
psychoakustischen Modellen sondern mit traditonelleren Methoden. Man
kann also den gesamten mp3-encoding-Prozess als zwei-Schritt-System
sehen: Zuerst die psychoakustischen Modelle anwenden, wobei Daten
weggelassen werden, dann die restlichen Daten komprimieren, um
Redundanzen zu vermeiden. Der zweite Schritt lässt keine Daten weg- er
ist verlustfrei!
- Die Frames werden in
einen (seriellen) Bitstream umgewandelt, vor jedem Frame gibt es header-Informationen,
welche essentielle Daten über das Frame angeben.
Der de-facto-Standard vor
noch einem Jahr war es, mp3s mit einer Rate von 128 kbps zu komprimieren.
Dabei gibt es z.T. heftige Kontroversen über die Frage, ob man in einem
128kbps-mp3 (stereo, 44.1 KHz) den unterschied zu CD-Qualität hört oder
nicht, und weitere Kontroversen über die Frage, ob nicht etwas
grundsätzliches verlorengeht, obwohl man den Unterschied nicht hören kann
("es ist nicht dasselbe!").
Inzwischen ist man vielfach dazu übergegangen, mp3s mit 160kbps und 192kbps
zu komprimieren. Dies hat stark mit den beständig steigenden Kapazitäten von
Festplatten und gleichzeitig sinkenden Preisen zu tun, außerdem besitzen- im
Vergleich zu von vor 4 Jahren- sehr viele PC-Besitzer CD-Brenner und
verwenden diese auch für die Archivierung von mp3s.
Es ist beim mp3-format (im Gegensatz zu JPEG) nicht möglich, den
Verlustfaktor bei der Kompression direkt anzugeben. Stattdessen kann man die
Anzahl der bits pro Sekunde angeben, was ein ähnliches Endresultat hat. Bei
einer niedrigeren Bitrate wird das codec "strikter" angewendet bzw.
Irrelevanz- und Redundanzkriterien werden schärfer beurteilt. Das hat
natürlich zur Folge, dass mehr Daten verworfen werden, was eine geringere
Qualität zur Folge hat.
Bitrates geben die Gesamtrate für alle komprimierten Kanäle an. Das bedeutet,
dass 128kbps stereo gleichbedeutend ist (sowohl in Größe als auch in
Qualität) mit 2 * 64kbps mono.
Variable Bitrate mp3s (VBR) sind mp3s, bei denen sich die Bitrate von Frame
zu Frame ändern kann. Ursprünglich war die Bitrate durch alle Frames konstant
(CBR). Tatsache ist jedoch, dass Musik in keinster Weise konstant
strukturiert ist- Passagen mit vielen Instrumenten und Stimmen werden von
Passagen mit sehr wenigen abgelöst usw. Bei der Kompression mit VBR wird eine
Toleranzschwelle angegeben, welche- verwirrenderweise- bei verschiedenen
Encodern verschiede mögliche Werte annehmen können (zB 0-10 oder 0-100).
Die Kompression von mp3s erfordert sehr viel mehr Ressourcen als die
Dekompression (Wiedergabe). Wiedergabe in Stereo / 128 kbps / 44.1 KHz
erfordert typischerweise mindestens einen Pentium 100.
Anwendung
Mp3s sind sehr weit verbreitet- man spricht oft von einem "mp3
boom". Sie werden überwiegend für die Wiedergabe von Musik in
CD-Qualität über das Internet verwendet. Obwohl es inzwischen Formate gibt,
welche über leicht bessere Kompressionsalgorithmen verfügen (wma), haben sie
sich bis jetzt kaum durchgesetzt. Zu dieser Entwicklung gibt es zahllose
historische Parallelen.
MOD
technisch
Anstatt das gesamte Musikstück in Samples zu zerlegen, werden hier nur die
Samples der verwendeten Instrumente abgespeichert und die sog.
"Partitur" des Musikstücks. Man unterteilt das Musikstück hier also
nicht in Abschnitte, sondern gliedert es mehr inhaltlich.
In einem mod-file stehen mehrere kurze Samplings, welche jeweils ein
Musikinstrument darstellen. Zusätzlich wird die Partitur mit den Noten
abgespeichert.
Man kann damit vorhandene Musikstücke natürlich nicht einfach digitalisieren-
es bedeutet einen hohen Produktionsaufwand. Auf der anderen Seite verringert
sich hier die Datenmenge immens, da nur die Instrumente und nicht das ganze
Stück als Sample abgespeichert werden.
Bis zur Position 20 ist der Titelname untergebracht. Falls dieser kürzer als
20 Zeichen sein sollte, wird der Rest mit Nullen aufgefüllt. Danach werden
bis zu 30 Samples abgespeichert: Diese Samples sind die einzelnen
Instrumente. Das bedeutet, daß nicht mehr als 30 Instrumente bei einem
Musikstück im MOD-Format benutzt werden können. Die Tonhöhe der einzelnen
Instrumente ist in achtel-Halbtonschritten variierbar. Sämtliche
Informationen, wie welches Instrument einzusetzen ist, sind in der Partitur festgehalten.
Die ersten mod-files entstanden auf dem Amiga, zu einer Zeit, wo die
Sound-Hardware von PCs nicht mehr als einige Piepser von sich geben konnte.
So ist es nicht verwunderlich, dass das Format von MOD-files genau auf die
Fähigkeiten der Amiga-Hardware abgestimmt ist (d.h. 8 Bit Auflösung, linear,
max. 28KHz Abtastrate, max. 4 Stimmen). Das Mischen der Stimmen geschieht auf
dem Amiga in Hardware, die Sample-Daten werden per DMA übertragen, sodass
selbst für heutige Verhältnisse lahme Prozessoren nur zu einem geringen Teil
belastet wurden.
historisch
1987 veröffentlichte Karsten Obarski, der damals für EIDOS Interactive
arbeitete, ein Programm namens Soundtracker. Tatsächlich legte er mit diesem
Schritt den Grundstein für eine ganze Szene.
Verglichen mit heutiger Musiksoftware bot Obarskis Software eher bescheidene
Möglichkeiten. Es gab keine Unterstützung für externe Instrumente wie Sample
oder Synthesizer, und dank des Amiga-Soundchips konnten nur 4 Stimmen
gleichzeitig wiedergegeben werden, echte Stereoausgabe war ebenfalls
unbekannt.
Die so genannten Modules bestehen aus einzelnen Samples und den Anweisungen
darüber, wann und wie diese gespielt werden sollen. Die Daten werden von
einem MOD-Player interpretiert.
Die Technik beeinflusste die Szene der Amiga-Musiker ganz wesentlich. Die
Samples konnten exportiert werden, die Programmierung lag offen, jeder Track
war eine Anleitung zum Selbermachen, jeder Remix nur einen Mausclick
entfernt. Es gab keine Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten.
Gerade aus diesen Gründen- weil jeder jedem in die Karten schauen darf- war
Originalität besonders gefragt. Außerdem hatte damals im Wesentlichen jeder
die gleichen technischen Voraussetzungen und konnte nicht aufgrund eines
besseren Equipments bessere Tracks produzieren.
Der Internetboom bedeutete so etwas wie einen Wendepunkt für die
Tracker-Szene: Mit der Zeit sahen die Musiker ihre Tracks nicht mehr nur als
Beiwerk zu Demos und emanzipierten sich von dieser Szene. Eigene Music-Groups
schlossen sich zusammen und bildeten im neuen Medium neue Vertriebsnetzwerke.
Einen kräftigen Schub bekam diese Entwicklung dann mit dem Aufkommen des WWW.
Die Gruppen designten sich eigene Websites und gaben sich damit ein eigenes
Gesicht; statt "music group" nannte man sich "net label".
Anstatt musik stilistisch wild durcheinander zu veröffentlichen, suchte man
sich seine Sparte. In den Jahren ´94 bis ´96 entstanden viele auch heute noch
engagierte Netzlabels.
Als der mp3-Boom ausbrach, hatten viele Tracker Angst, vom neuen Format
überrollt zu werden. Die öffentliche Diskussion spitzte sich auf mp3.com und
illegale mp3s zu, Trackerlabels waren den meisten Neulingen im Netz
unbekannt. Einige Sites sahen darin auch die Chance, mehr Aufmerksamkeit zu
bekommen: Seit einem Jahr bietet die Site ModPlug Central (www.modplug.com)
mp3s an, die gleichzeitig als mod veröffentlicht werden und so die
"Angst" vor dem unbekannten Format nehmen sollen. Modplug Central
möchte damit mod-files als unkommerzielle Alternative zu Plattenlabeln und
Raubkopien empfehlen.
In den letzten Jahren haben jedoch immer mehr Trackerlabels das mp3-format
für sich entdeckt, der open-source-Gedanke geht dabei zwangsläufig verloren.
Bandbreite spielt heute eine geringere Rolle bei der Distribution der Musik,
und auch der durchschnittliche PC ermöglicht, was früher nur Studios mit
professionellem Equipment vorbehalten war. Auch die Trackerentwicklung hat
eben vor dem technischen Fortschritt nicht haltgemacht.
Anwendung
Tatsächlich sind mod-files den vielen neuen Benutzern des Internet und
Personen, welche sich nicht seit Anfang der 90er Jahre mit Computern
befassen, weitgehend unbekannt. Tatsächlich gab es mod-files natürlich auch
auf dem PC, doch ihre Nutzung beschränkte sich auf wenige Interessierte und "Power
User" des PC. Der sog. "mp3 boom" beschränkt sich indessen
nicht nur auf erfahrene PC-Benutzer, sondern hat unabhängig von der Erfahrung
mit dem Umgang des Computers praktisch grosse Teile des Internets befallen.
Diese Entwicklung hat sicher auch mit der fortschreitenden Vereinfachung der
Bedienung eines Computers (Betriebssysteme mit grafischer Benutzeroberfläche
etc) im Vergleich zum Stand Anfang der 90er Jahre zu tun.
MIDI
technisch
Midi erzeugt keine eigentlichen Tondateien, sondern legt "nur" intern
eine Liste an, mit welchen Mitteln das vorhandene Hardware-Equipment
(Soundkarte mit MIDI-Interface) bestimmte Instrumente "nach"spielen
soll. "MIDI-Musikstücke" können auf jedem Rechner unterschiedlich
klingen.
Das MIDI-Format ist dem MOD-Format im Prinzip sehr ähnlich, nur fehlen hier
die Samples der einzelnen Instrumente. Statt der Informationen über die
einzelnen Instrumente sind bei diesem Format dort nur Nummern verzeichnet.
Die entsprechenden Instrumentinformationen zu den Nummern müssen dann in einer
speziellen Software oder auf der Hardware realisiert werden.
Die meisten Soundkarten besitzen eine MIDI-Schnittstelle. Weiters sind sie in
der Lage, selbst solche MIDI-Sequenzen zu verarbeiten und dazu die
entsprechenden Töne zu erzeugen. Die Töne sind in digitaler Form auf der
Karte abgelegt, im sog. Wavetable-ROM. Bessere Karten verfügen zusätzlich
über ein RAM, wo man selbst neue Sounds ablegen kann. Der MIDI-Teil einer
Soundkarte lässt sich jedoch auch in Software nachbilden.
Da keinerlei Samples untergebracht werden müssen, ist das Format natürlich
unheimlich "klein". Andererseits ist eine getreue Wiedergabe des
Musikstücks fast nicht möglich, da häufig die genauen
Instrumenteninformationen nicht vorhanden sind und jeder Hersteller solche
Instrumentensamples etwas anders gestaltet. Einigkeit besteht zumindest
darin, dass eine Gitarre wie eine Gitarre klingen soll und ein bestimmter
Grundvorrat an Instrumenten immer vorhanden ist.
Ein weiteres, grundsätzlicheres Problem bei MIDI ist- ebenso wie bei MOD-
dass kein Gesang abgespeichert werden kann, da sich die Stimme nicht wie ein
einfaches Instrument samplen lässt. Grade bei neueren Musikstilen wie Techno
können diese Formate eine echte Alternative sein.
historisch
Mitte der 80er Jahre tasteten sich die Musikstudios vorsichtig auf das neue
Feld der auf MIDI-Recording und Soundsampling basierenden Musikcomputer vor.
Die ersten Geräte befanden sich damals z.T. in Privatbesitz von Dozenten an
Universitäten. Anfang 1986 startete Wolfgang Martin Stroh eine Artikel-Serie
in der Zeitschrift "Populäre Musik im Unterricht" mit Tips und
Praxistests für den Commodore-Einsatz.
1987 begann der Einstieg in die Digitalära und das Midi-Recording. Bis heute
wird z.T. noch auf den robusten Atari ST gearbeitet.
Der Atari ST war der erste Rechner, welcher über eine MIDI-Schnittstelle
verfügte. Damit zog er in die Musikstudios ein.
Vergleiche
Eine Stunde aufgezeichneter Musik benötigt mit 16 bit, 44KHz Stereo (unter
der Voraussetzung, dass sie in CD-Qualität wiedergegeben werden soll) im
WAV-Format ca. 600 MB. Im MOD-Format erreicht man zwar keine CD-Qualität,
kommt aber schon mit 1/10 des Speicherplatzes aus. Bei MIDI ist man dann
schon bei nur 200 KB angekommen. Allerdings kann man hier auch beim besten
Willen nicht mehr von CD-Qualität sprechen.
Wenn man sich den Speicherverbrauch und die Qualität der Wiedergabe der
einzelnen Formate ansieht, versteht man, warum man so interessiert daran ist,
die Musik als ganzes zu samplen, danach aber so zu komprimieren, dass man ohne
spürbaren Qualitätsverlust mit einem Bruchteil des ursprünglichen
Speicherplatzes auskommt -> mp3!
Während mp3s und wavs sich weltweit eines großen Nutzerkreises erfreuen, sind
midi-files und wohl vor allem mod-files der "neuen Generation" der
(Internet-) Benutzer wohl weitgehend unbekannt.
|
|
Was ist ein Soundtracker?
Im wesentlichen handelt es sich bei einem Soundtracker um ein Tool, mit dem
Samples in einer festgelegten zeitlichen Reihenfolge plaziert werden können.
Zusätzlich können auf diesen Samples noch einfache DSP-Aktionen ausgeführt
werden (Tonhöhe verändern, Echo, Portamento). In gewisser Weise ist also ein
Soundtracker mit einem Midi-Sequencer vergleichbar, der ebenfalls für die
Aufzeichnung der zeitlichen Aneinanderreihung von Events verantwortlich ist.
Der große Unterschied ist aber einerseits die Art, wie Klänge erzeugt werden,
und anderersseits das verwendetete Fileformat. Während im Midi-Format
Zeitpunkt (Note On, Note Off-Events), das verwendete Instrument (z.B. nach
dem GM-Standard), Höhe und einige andere Effektinformationen in einem
standardisierten Format abgespeichert werden (siehe http://www.midi.org/), sind im MOD-Format der
Soundtracker die verwendeten Samples bereits im File inkludiert (siehe http://www.wotsit.org/download.asp?f=modfil11).
Grundsätzlich ist ein Soundtracker-Modul (so werden die Songs genannt) aus
Patterns aufgebaut, die dann beliebig oft wiederholt und aneinandergereiht
werden können.
Die einzelnen Spuren ("Tracks") eines Moduls werden spaltenweise
angeordnet, wobei jede Zeile in einer Spalte einem Beat in einem festgelegten
Raster entspricht. So lässt sich beispielsweise eine Zeile mit einer
16tel-Note assozieren, 16 Zeilen entsprechen dann einem Takt. Für jede
gesetzte Note steht an erster Stelle der Ton, die Oktave und dahinter noch
zusätzliche Informationen (Portamento, Vibrato,...).
Die Eingabe findet bei Trackern grundsätzlich über die Tastatur statt, wobei
eine Klaviertastatur auf das Computerkeyboard gemappt wird.
Die Eingabe der Patterns kann einerseits "in Echtzeit" geschehen,
oder aber im Editiermodus, hier kann man dann auch Effektinformation genau
angeben und beispielsweise fließende Übergänge zwischen Noten realisieren
("Portamento").
historisches
Der erste Soundtracker wurde von Karsten Obarski im Jahr 1987 für die
Amiga-Plattform veröffentlicht. Der Amiga konnte bereits vier unabhängige
Spuren mit 8 Bit Auflösung wiedergeben, dadurch konnten bei effizienter
Ausnutzung der Ressourcen bereits relativ komplexe Musikstücke wiedergegeben
werden. Die meisten Soundtracks für Amiga-Spiele wurden damals auf
Soundtrackern komponiert.
Später gelang es, mit Hilfe von Tricks 8 Spuren auf einem Amiga wiederzugeben
(Oktalyzer). Mit der steigenden Verbreitung von IBM-PC's (und kompatiblen) im
Heimbereich und der Verfügbarkeit von technisch immer ausgereifteren
Soundkarten (allen voran der Soundblaster von Creative Labs) verbreiteten
sich auch in diesem Bereich die Soundtracker-Clones (Noisetracker).
Heute ist der Ur-Soundtracker nur für die Linux/XWindow-Plattform
erhältlich (siehe http://www.soundtracker.org), für MS Windows gibt es derzeit
keine funktionierende Portierung. Es existiert jedoch eine ganze Reihe von
(oft um viele Features erweiterten) Tracker-Derivaten für Windows (siehe http://www.soundtrackers.de).
Features / Weiterentwicklungen
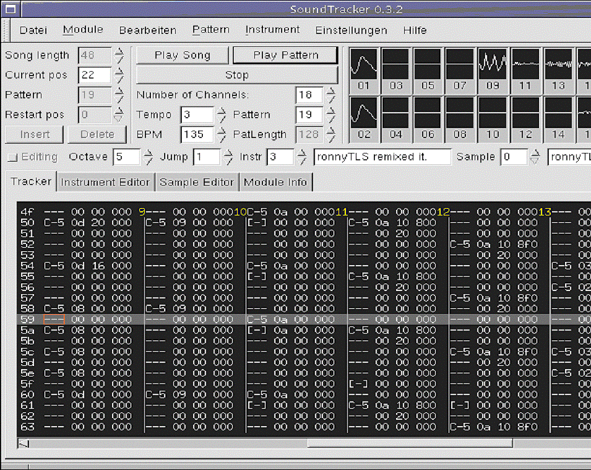
Abbildung 1: Main window eines typischen
Soundtracker
Im Laufe der Zeit wurden die Soundtracker um immer ausgefeiltere Features erweitert.
So wurden z.B. mehr oder weniger leistungsfähige Sample-Editoren integriert
(Abbildung 2).
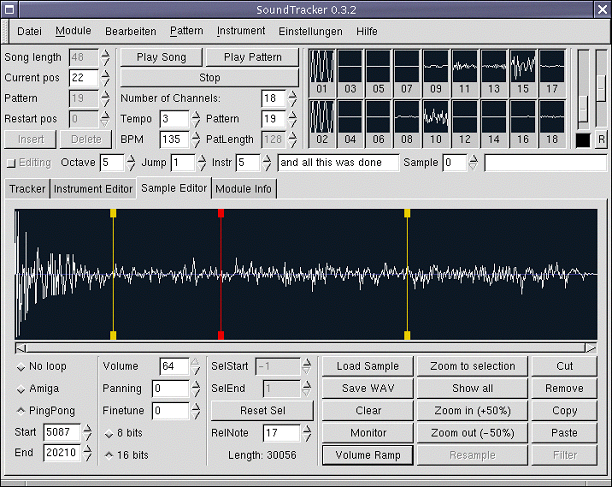
Abbildung 2: Sample-Editor
Sample-Editoren gestatten es, Sound aufzunehmen und ihn mit Hilfe von Cut-,
Copy- und Paste-Operationen nachzubearbeiten. Ausserdem ist es möglich,
Sounds als "Loop" zu definieren, d.h. dass man beispielsweise einen
Drumbeat zyklisch wiederholen kann. Als besonders nützlich erweist sich auch
ein Instrument-Editor, mit dem es möglich ist, Parameter wie das Ausklingen
des Instruments oder Effekte festzulegen (Abbildung 3).
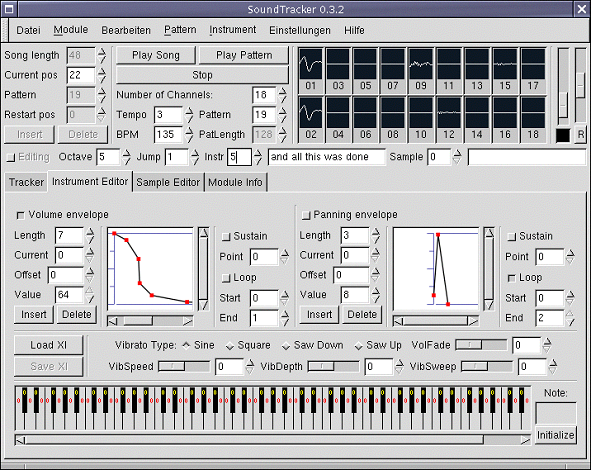
Abbildung 3: Instrument-Editor
Was ist Reason?
Ohne Übertreibung kann man Reason aus der schwedischen Musiksoftwareschmiede
Propellerhead ( http://www.propellerhead.se/)
als revolutionäre Software bezeichnen. Grundsätzlich besticht es durch
folgende Features:
- Intuitives UI, die
Bedienung ähnelt in verblüffender Weise ähnlich funktionierender
Hardware.
- Qualität der
erzeugten Sounds, bei verhältnismäßig niedrigen Anforderungen an den
Rechner.
- Außer einer 16
Bit-Soundkarte und einer hinreichend schnellen CPU (läuft problemlos auf
einem PII 350) gibt es keine zusätzlichen Anforderungen an die Hardware.
Dem User präsentiert sich
Reason als virtuelles Studio-Rack, in das verschiedene Klangerzeuger,
Sequencer, Effektgeräte und Mischer eingesetzt werden können. Dabei geschieht
die Zusammenstellung und Verkabelung der Geräte vollkommen grafisch und per
Drag&Drop (siehe Abbildungen 4 und 5).
Welche Komponenten beinhaltet Reason?
Neben Geräten wie Sequencern, Analog-(Software)Synths, Mixern, Drumcomputern
und Effektgeräten gibt es auch Sampler, Loop-Player und Midi-Input-Devices.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Audio-Output über das ReWire-Protokoll
an Software wie Steinberg Cubase VST oder Logic Audio umzuleiten und dort zu
mischen bzw. mit Effekten nachzubearbeiten.
Indem man [TAB] drückt, kann man das gesamte Rack von hinten betrachten (Abb.
5) und mit Hilfe der Maus die einzelnen Geräte miteinander verbinden. Dabei
verfügt jedes klangerzeugende Gerät über einen CV (Control Voltage) und einen
Gate-Eingang, das mit einem entsprechenden Ausgang eines steuernden Gerätes
verbunden werden kann. Effektgeräte können - so wie bei einem echten
Studiomischpult - in den Effektweg des Reason-Mischpultes eingeschleift
werden.
MIDI-Integration
Alle Geräte in Reason können über Midi kontrolliert werden. Dabei kann Midi
sowohl bei der Komposition (beispielsweise können Synthesizer-Spuren mit
einem Keyboard eingespielt werden) als auch im Production Level eingesetzt
werden. So kann Reason komplett über einen anderen Sequencer kontrolliert
werden, und auf diese Weise kann es auch in komplexen Studio-Environments
eingesetzt werden.
Mittels des ReWire2-Protokolls ist es möglich, Reason von Cubase aus zu
verwenden. Cubase fungiert dann als Sequencer und Reason übernimmt nur mehr
die Klangerzeugung.
Vergleich
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass sich die Ansprüche, die an
Musiksoftware gestellt werden, im Laufe der Zeit stark verändert haben. So
ist es vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen, mit Hilfe eines
Software-Synthesizers hochqualitative Sounds zu erzeugen, sie durch ein
Mischpult zu routen und gleichzeitig mit Effekten zu versehen und dann
digital auf einer Harddisk zu speichern.
Es hätte also wenig Sinn, die technischen Daten der Programme direkt
gegenüberzustellen. Ich werde jedoch versuchen, einige Anwendungsszenarios
und (Un)Möglichkeiten für den Einsatz der Programme zu zeigen.
Während es sich bei einem Soundtracker - wie schon weiter oben erwähnt - um
eine Software handelt, die im wesentlichen nichts anderes tut, als Samples in
einer zeitlich festgelegten Abfolge und in unterschiedlicher Geschwindigkeit
abzuspielen, bietet Reason viele Möglichkeiten, die in einem modernen Studio
vorzufinden sind. Daraus folgt, dass sämtliche Sounds, die ein Tracker
wiedergeben kann, in Form eines Samples vorliegen müssen, während Reason die
Möglichkeiten der künstlichen Klangerzeugung mit Software-Synthesizern
bietet. Reason kann jedoch auch die von einem Tracker gebotenen Möglichkeiten
mit Hilfe des integrierten Pattern-Sequencers und des Digitalsamplers
abdecken. Hier zeigt sich ein kleiner "Vorteil" der Soundtracker
gegenüber dem modular aufgebauten Reason, da in die meisten Tracker bereits
ein kleiner Sample-Editor mit Aufnahmemöglichkeit eingebaut ist. Dieser
Vorteil wird jedoch durch die Verfügbarkeit leistungsfähiger Editoren (e.g.
Cool Edit, Propellerhead ReCycle, Steinberg WaveLab) mehr als kompensiert.
Genau hier schließt auch der nächste große Vorteil von Systemen wie Reason
an: Durch die Midi-Fähigkeit und das ReWire-Protokoll von Propellerhead wird
die Integration sowohl mit Midi-Hardware als auch mit anderer Software
(Steinberg Cubase, Logic Audio) zum Kinderspiel. So kann man beispielsweise
ein Laptop mit Reason und Cubase VST nahtlos in ein bestehendes Midi-Setup
integrieren. Ein PC/Laptop wird somit zum (portablen) Synthesizer, Sampler,
Sequencer und Effektgerät und das alles bei professioneller Soundqualität.
Somit sind eigentlich auch die Zielgruppen definiert: Während die
Soundtracker eindeutig für den Homecomputer- und später Home-PC-Anwender und
für Spieleprogrammierer entwickelt wurde, zielt Reason eindeutig auch auf den
professionellen Bereich ab. Allerdings ist es aufgrund seines relativ
niedrigen Preises auch für Homerecording-Anwendungen und Hobbymusiker
erschwinglich.
Der Preis ist aber gleichzeitig der größte Vorteil der Soundtracker, da
mittlerweile alle Tracker als freie Software bzw. Shareware existieren.
Allerdings glaube ich, dass der hohe Entwicklungsaufwand den Preis von Reason
mehr als rechtfertigt, und wenn man sich mal die Preise für entsprechende
Hardware ansieht, ist das Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar.
Fazit
Zweifelsohne waren die ersten Soundtracker mit den damals überragenden
Soundfähigkeiten des Commodore Amiga beeindruckend. Allerdings sind die
Schwächen der Tracker offensichtlich. Die nicht vorhandene Midi-Integration
und die Beschränkung auf gesampelte Sounds schränken das Anwendungsfeld sehr
ein, da es mittlerweile andere Sampler-Software gibt, die außerdem über Midi
angesteuert werden kann, sind Tracker heute eine Spielerei für Freaks und
nicht mehr.
Mit der Veröffentlichung des Realtime-Softwaresynthesizers mit integriertem
Sequencer, Rebirth, sorgte Propellerhead bereits für Gesprächsstoff in der
Szene. Mit dem neuen Tool Reason wurden jedoch sowohl in puncto Soundqualität
und als auch Usability neue Maßstäbe gesetzt. Bereits nach kurzer
Einarbeitungszeit kann man - einige Erfahrung mit Sound-Hardware
vorausgesetzt - erste Ergebnisse erzielen, für den Profi bietet es alle nur
erdenklichen Features, vor allem auch in der Integration mit anderer
Software.
Natürlich muss gesagt werden, dass Reason/Rebirth bei weitem nicht die
einzigen Softwaresynthesizer-Systeme sind. Für eine umfangreiche Liste siehe http://www.synthzone.com/softsyn.htm.
Es gibt andere System, z.B. csound (http://www.csound.org),
die über eine eigene Programmiersprache gesteuert werden können, und die noch
viel weitreichendere Möglichkeiten, u.a. aber auch die
Realtime-Softwaresynthese, bieten. Allerdings liegt der Schwerpunkt beim
System Reason eben auch im User Interface, und dieses User Interface ist
bisher wirklich einzigartig.
Der Trend hin zu den Softwaresynthesizern wird sicher Auswirkungen auf die
Art, wie Musik komponiert und produziert wird, aber auch - zusammen mit
Entwicklungen wie mp3 oder anderen "netztauglichen" Audioformaten -
auf die gesamte Musikbranche, und das sowohl in qualitativer Hinsicht, als
auch auf die Beziehung zwischen Komponisten/Künstlern, Produzenten und
Plattenfirmen/Verlegern haben. Hier sehe ich aber auch Chancen für Musiker,
da mit der Verfügbarkeit professioneller Software im Consumer-Bereich dem
Trend hin zum völlig gesichtslosen Musiker, dessen Image nur noch von einer
Marketingabteilung festgelegt wird und der aufgrund der Notwendigkeit
professioneller Produktionstechnik und eines funktionierenden Vertriebs
Produzenten und Plattenfirmen vollkommen ausgeliefert ist, entgegengewirkt
werden könnte. Das trifft zwar nur auf den Bereich der elektronischen Musik
zu ("richtige" Bands werden nach wie vor kaum um einen Vertrag herumkommen
- man sehe sich einmal die Kosten für eine professionelle CD-Produktion im
Detail an), gerade in diesem Bereich wird aber von den großen Konzernen am
meisten Geld umgesetzt und gerade hier sinkt das Niveau immer tiefer. Das
Argument, es könnte mit Hilfe solcher Tool "ein jeder so einen Mist
produzieren", kann ich nicht gelten lassen, da gerade ein freier
Wettbewerb, in dem nicht von Plattenfirmen diktiert wird was gut und was
schlecht sei, für eine andere Bewertung der diversen "DJ Ötzis" und
Konsorten sorgen könnte.

Abbildung 4: Frontansicht des Reason-Racks

Abbildung 5: Rückansicht des Reason-Racks
|
|
Langspielplatten
Die älteste Form Musik auf Scheiben zu verfrachten ist die Long Play Platte. Die
Musikqualität ist in den von mir vorgestellten Trägern sicherlich die
schlechteste, allerdings findet sie nichtsdestotrotz auch heute noch
Anwendung. Im Gegensatz zu den Kontrahenten wird die Musik auf Schallplatten
(LP's) in analoger Form gespeichert, was zwar eine genaue Aufzeichnung der
Musik bedeutet, die Abtastung ist jedoch derart fehleranfällig und ungenau
dass sie nicht mehr genau so widergegeben werden kann wie sie aufgenommen
wurde.
Kurioses nebenbei: Schallplatten lassen sich inzwischen mittels eines
3D-Scanners so genau abtasten dass sich die dadurch gewonnenen Rillen und
somit der gespeicherten Musikinformation auf der Plattenoberfläche mittels
Berechnungen in Hochqualitative digitale Musik im MP3 Format umwandeln
lassen.
Somit ist eine Schallplatte nicht mehr nutzlos, sondern eigentlich einer CD
fast gleichwertig. Das Abtasten mittels 3D-Scanner ist jedoch mit hohen
Kosten unterbunden, als noch nicht Marktreif und sicherlich nur für besondere
Platten einsetzbar, da es sich sonst einfach nicht lohnt.
Der Schall wird bei Schallplatten so aufgezeichnet wie er in der Natur auch
vorkommt, nämlich als sich fortbewegende Wellenform.
Die Aufzeichnung erfolgt mittels einer Nadel welche durch eine Membran,
welche den Ton aus der Umgebung abnimmt in Schwingung gesetzt wird. Auf der
Platte wird somit ein vertieftes Abbild dieser Schallschwingungen erstellt.
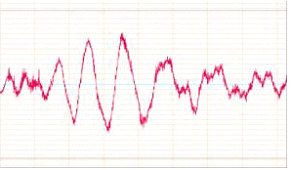
Das Abspielen der Schallplatte erfolgt auf die selbe Weise. Eine in der
fortlaufenden Rille auf der Schallplatte angesetzte Nadel welche durch das
abtasten in di selbe Schwingung versetzt wird wie auf der Platte eingeritzt,
leitet die Schwingungen an eine Membran weiter, welche sie als Ton an die
Umgebung abgeben kann.
Anfangs war die Schallplatte eine zylindrische mit einer Metallfolie
beschichtete Walze. Da diese aber ziemlich schlecht in der Massenproduktion
hergestellt werden konnte kam man zur heutigen Form, nämlich der Scheibe.

Die durchlaufende Rille beginnt dabei am äußersten Rand und folgt der Platte
spiralenförmig bis kurz vor dem Mittelpunkt der Platte.
Im Jahre 1887 erfand der in Deutschland geborene Amerikaner Emil Berliner
eben diese Form der Schallplatte, der heutigen Vinyl-platte. Anfangs benutzte
man dafür ein Gemisch aus Schellack, Schiefer, Asbest, Ruß und Schwerspat.
Diese Vinylplatten lassen sich schnell durch eine einfaches Pressverfahren
beliebig oft vervielfältigen, was sehr positiv für die Massenproduktion ist.

Der Schall kann auf zwei verschiedene Arten auf die Platte aufgetragen
werden. Es gibt dabei die Tiefenschrift, die sogenannte Edisonschrift und die
Seitenschrift, die sogenannte Berlinerschrift. Die Tiefenschrift ist der
historische Vorgänger der leichter maschinell zu erzeugenden Seitenschrift
und wurde natürlich durch die Seitenschrift abgelöst welche auch heute noch
gängig ist. Bei der Tiefenschrift wird die Schallwelle in Form von tieferen
bzw weniger Tiefen Rillen auf die Platte aufgetragen. Hingegen wird bei der
Seitenschrift, wie sicherlich bereits vermutet, die Welle durch Links -und
Rechtsschwenkungen gespeichert.
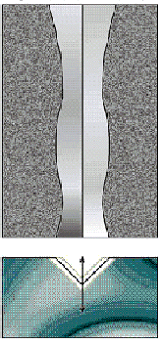
Im Laufe der Zeit wurden die Platten ständig verbessert, es gab verschiedene
Größen und verschiedene Abspielgeschwindigkeiten um mehr und mehr Ton auf
eine Scheibe verfrachten zu können. Die Seitenschrift wurde aber stets
beibehalten. Mit dem Einführen von elektronischen Geräten wurde es ermöglicht
die Rillen durch einen Abtaster (meistens aus Diamant) in elektronische
Impulse umzuwandeln welche beliebig verstärkt werden konnten. Während es bei
alten Platten nur Monoaufnahmen gab wurden nun Stereo-Platten vonnöten.
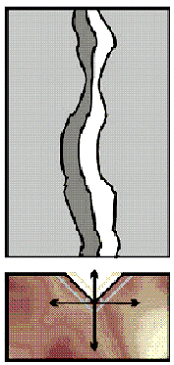
Aus diesem Grund, nämlich um zwei Kanäle auf der Platte zugleich speichern
zukönnen musste man eine Kombination aus Seiten- und Tiefenschrift einführen.
Die Nadel muss somit nicht nur Nach links und rechts sondern auch nach oben
und unten Ausschlagen. Aus diesem Grund konnte trotz der großen
Platzersparnis und somit steigerund der Kapazität, welche die Tiefenschrift
gebracht hätte nicht mehr auf sie zurückgegriffen werden.
Einige Daten
Die Standard LangspielPlatte (LP) hat einen Durchmesser von 12 Zoll und wird
mit 33 r.p.m abgespielt.
Weiters gibt es Single-Platten mit zwei bis vier Titel pro Platte. Sie haben
unterschiedliche Durchmesser werden jedoch mit 45 r.p.m abgespielt. Durch die
beiden verschiedenen Abspielgeschwindigkeiten wurde ein Krieg der beiden
Standards entfacht, denn man konnte lange Zeit am Plattenspieler die
Abspielgeschwindigkeiten nicht auswählen.
Heutzutage ist dies natürlich möglich, allerdings kaum mehr notwendig, denn
die Platte wurde um 1993 schnell durch die CD abgelöst.
Ein verzweifelter Versuch eines Comebacks der Schallplatten durch Einführung
eines neuen Standards, dem Direct Metal Mastering (DMM) bei welchem die Platte
durch einen Laser abgetastet wird, schlug kläglich fehl, da das Gerät im
Gegensatz zum CD-Player einfach zu teuer war.
Heutzutage findet die Schallplatte nur mehr unter Nostalgikern und als
Instrument der DJ's und "Scratcher" im Vergleich zu der CD minimalen
Einzug.
Compact Disc (CD)
Die CD ist der Datenträger der sich in der letzen Zeit am schnellsten
durchsetzen konnte. Sie löst die LP mit einer besseren Musikqualität und dazu
noch einem kleineren und handlicherem Format ab.
Die CD hat im Normalfall eine Kapazität von 74 Minuten und 33 Sekunden, eine
Umdrehungsgeschwindigkeit von 1,2-1,4 m/s das wären 200-500 U/sec. Der
Durchmesser der CD ist 120 mm und damit eindeutig kleiner als die LP'S. Die
Scheibe ist 1,2 mm dick und besteht aus einem transparenten Material mit
einem Brechungsindex von 1.55 (z.B Polycarbonat).
Die Daten werden auf der CD in digitaler Form gespeichert. Das bedeutet dass
der in der natur Vorkommende analoge Schall erst in digitale Werte
umgewandelt werden muss. Dies erledigt ein Analog - Digital Wandler
(A/D-Wandler). Diesem A/D Wandler muss durch eine Abtastfrequenz angegeben
werden wie oft pro Zeiteinheit ein Wert von der Originalschwingung, also der
Wert der Amplitude gelesen werden soll. Diese Abtastfrequenz ist normalerweise
44.100Hz. Eine höhere Abtastfrequenz wird eine genauere bzw. bessere
Annäherung an die Originalschwingung liefern, jedoch geht dies auf Kosten des
Speicherplatzes auf dem Medium.
Die Abtastfrequenz ist deshalb so gewählt, da das menschliche Gehöhr keine Signale
oberhalb von 20kHz wahrnehmen kann. Das Nyquist Theorem besagt dass die
Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß sein soll wie die größtmögliche
vorkommende Signalfrequenz. Werte welche über die 20KHz hinausgehen werden
vom Aufnahmegerät durch einen Tiefpass abgeschnitten. Da es jedoch keinen so
perfekten Tiefpass mit einer so steilen Flanke gibt können Werte bis zu 22kHz
vorkommen. So erhält man den Wert von 44.1kHz.
Die so erhaltenen Werte werden nun quantisiert, d.H sie werden in Intervalle
eingepasst. Im Normalfall wird der Wert mit 16 Bits codiert. Auch hier gilt,
je größer das Intervall desto besser die Qualität desto größer die
Anfallenden Datenmengen.
Die erhaltenen Werte sind nun Bitfolgen und können auf beliebige Medien
abgespeichert werden. Die CD hat sich als solches Medium durchgesetzt, da sie
ähnliche Qualitäten wie die Schallplatte aufwies und dabei qualitativ viel
besser abschnitt.
Wie wird die Information nun genau abgespeichert?
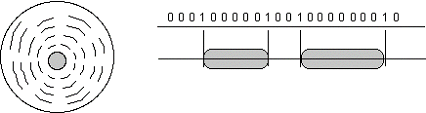
Die erhaltenen Audiodaten bestehend aus einem binären Code der aus 0 und 1
besteht werden in Form von "Pits" und "Lands" auf der Cd
gespeichert. Pits sind Vertiefungen und Lands sind nicht vertiefte Stellen.
Ein Laserstrahl tastet beim abspielen dabei die sich drehende Scheibe von
innen nach außen ab. Das kohärente Licht des Strahls wird von den Pits und
Lands unterschiedlich zurückgestrahlt. Nach der Ablenkung durch ein Prisma
wird der zurückgeworfene Laserstrahl von einem Photosensor aufgenommen und in
elektrische Impulse umgewandelt.
Damit die Pits und Lands auch überhaupt Licht zurückwerfen wird die Cd mit
einer sehr dünnen (50-100nm) Metallschicht (Aluminium, Silber, Gold) bedeckt.
Zum Schutz dieser Schicht wird darauf noch eine dünne Kunststoffschicht
(10-30µm) angebracht auf welcher das Label der Cd aufgedruckt ist. Der
Laserstrahl durchwandert somit die transparente Schicht und landet auf den
mit metallisierten Böden versehenen Pits und Lands. Bei Lands wird das
Laserlicht als ganzes reflektiert und bei Pits wird der Strahl gestreut.
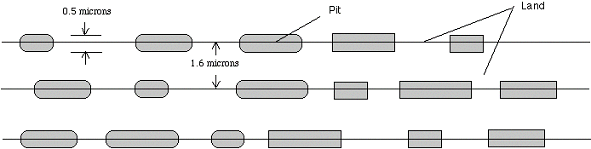
Fehlerkorrektur
Während sich bei der LP Fehler wie Kratzer oder Verunreinigungen durch
Rauschen bemerkbar machten ist dies bei der CD nicht so stark der Fall und
zwar aus einem einfachen Grund. Dadurch dass die Lands und Pits so
mikroskopisch klein sind, gibt es bereits ab dem Werk Fehler innerhalb
geregelter Toleranzen. Bei Gebrauch lassen sich Kratzer aber nicht vermeiden,
deshalb muss die CD über eine Fehlerkorrektur verfügen. Die unvermeidbaren
Fehler werden somit durch die Fehlerkorrektur ausgemerzt. Wenn eine CD sehr
stark beschädigt ist kann natürlich die beste Fehlerkorrektur nicht mehr
helfen.
Standards
Schon bald wurde die CD Standardisiert um jeglichem Benutzer
unterschiedlicher CD-Player die selben Möglichkeiten zu bieten. Die Standards
wurden in den sogenannten Books festgehalten.
Die meisten weiterentwickelten Books sind für Audio nicht interessant sondern
beschreiben lediglich Videoformate Fotocds oder ähnliches.
Red Book (CD-DA)
Dieses Book erlaubt bis zu 74 Minuten digitale Musik.
- Die Samplerate
(Abtastfrequenz) ist auf 44,1kHz festgelegt, was 44100 Samples in der
Sekunde entspricht.
- Die Transferrate
welche der Player schafft ist auf 150 kbytes in der Sekunde festgelegt.
Dies ist auch als Singlespeed (1X) bekannt
- Die CD kann bis zu
99 Tracks beinhalten
Das Redbook ist auch unter
dem Namen CD-DA (Compact Disk Digital Audio) bekannt. Die beiden Firmen Sony
und Philips schufen diesen Standard im Jahre 1980 als einen Standard der
einfach eine universelle Methode digitalisierte Musik zu vertreiben
darstellte.
Dieser Standard wurde jedoch bald dazu benutzt um andere Daten abspeichern zu
können.
Eine Red Book Cd ist in drei Teile eingeteilt: Das Lead-In, die Daten und das
Lead Out. Jeder Track auf der CD ist im TOC (Table of Contents) festgehalten,
welches im Lead In einer jeden CD gespeichert ist.
Dieser Standard ist der Vorreiter aller darauffolgender Books.
Minidisc
Die MiniDisc sollte die CD ablösen konnte sich jedoch wegen des florierens
des MP3 Formates durch das Internet nicht so richtig durchsetzen.
Der Unterschied zur CD besteht vor allem darin dass die MiniDisk um einiges
kleiner und handlicher ist, dadurch werden die Player natürlich ebenfalls
viel kleiner und handlicher, was der eigentliche Wunsch gewesen ist. Nebenbei
kann man die MiniDisc auch beschreiben und wiederbeschreiben. Für die
Musikindustrie ist dies nicht mehr so positiv, jedoch kann sie mit MiniDiscs
und einer eingeschränkten Möglichkeit der Anfertigung von Kopien der
Musikpiraterie entgegenwirken, da die illegale Anfertigung von CD Kopien
inzwischen einem jeden offen steht. Die Idee wäre eigentlich gut gewesen,
wenn nicht das MP3 Format das kopieren von Musik noch wesentlich vereinfacht
hätte.
Die MiniDisc hat so viel Speicher auf so engem Raum vor allem deswegen Platz,
weil Frequenzbereiche, welche das menschliche Gehöhr nicht wahrnehmen und
Töne welche durch andere Töne so überlagert werden dass sie ebenfalls nicht
hörbar sind, rausgeschnitten werden und somit eine stattliche Menge unnützer
Daten entfernt wird.
|
|
Geschichtliches
Die Minidisc ist ein System zur Speicherung von Audiodaten. Es wurde im Jahre
1992 von Sony entwickelt und besteht aus einer 2,5“ großen Catridge die einem
somit geschützten magnetooptischen Datenträger enthält. Man kann sie wie eine
Kassette beschreiben, löschen und wieder beschreiben. Und das bis zu eine
Million Mal.
Im gewissen Sinne ähnelt die Minidisc der CD, da sie mittels eines Lasers
gelesen wird und die Speicherung der Daten digital erfolgt. MD’s, so die
Kurzbezeichnung der Minidiscs, verwenden das im Computerbereich eingesetzte
magneto-optische Verfahren.
MD’s sind in zwei Ausführungen erhätlich: 60 und 74 Minuten. Somit können die
MD’s gleich viel Daten aufnehmen wie eine herkömmliche CD mit 650 MB. Die MD
verfügt nur über ein Platzangebot von 140 MB. Sony erreichte durch das
sogennannte ATRAC – Verfahren eine Kompressiondichte von 5:1. Die ATRAC
Kompression verwendet dazu ein psychoakustisches Verfahren und der
Unterschied ist für den Menschen nicht wahrnehmbar.
Die MD wurde anfangs nur in den USA verkauft und eingesetzt. Erst in den
letzten Jahren interessierten sich immer mehr Hersteller wie SHARP, KENWOOD,
JVC usw. für die MD und brachten ihre eigenen Geräte auf den Markt. Dies
führte wiederum zu einer eindeutigen Verbilligung der Minidisc.
ATRAC Kompression
ATRAC steht für Adaptive Transform Acoustic Coding
Bei ATRAC handelt es sich
um eine intelligente Komrpimierungsmethode, die nicht einfach nur blind aus
einem Musikstück ausliest, sondern versucht, dem menschlichen Gehör
vorzutäuschen, dass es sich hier um das Originalstück handelt, ohne
Qualitätsverlust. Das Endresultat: Musik die kling wie die Originalvorlage,
aber eben 1/5 der Größe des Ursprungsstückes. Da sich das Wahrnehmungsmodell
ständig  ändert wird auch der ATRAC Algorithmus
ständig verbessert, um so eine noch bessere Qualität zu gewährleisten.
Deshalb wird der Minidisc nachgesagt, dass sie von besserer Qualität ist als
MP3. Wie bereits erwähnt gibt es mehrere Versionen von ATRAC. Am Anfang hieß
das Verfahren noch ADC und DAC. Da das Verfahren damals noch nicht ausgereift
war und die Geräte noch extrem teuer waren, wurde die MD bald totgesagt. Erst
die Verfahren ATRAC 2 und ATRAC 3 konnten überzeugen. Mit ATRAC 4 wurde sogar
eine wesentlich bessere Qualität als die der CDs erreicht. ändert wird auch der ATRAC Algorithmus
ständig verbessert, um so eine noch bessere Qualität zu gewährleisten.
Deshalb wird der Minidisc nachgesagt, dass sie von besserer Qualität ist als
MP3. Wie bereits erwähnt gibt es mehrere Versionen von ATRAC. Am Anfang hieß
das Verfahren noch ADC und DAC. Da das Verfahren damals noch nicht ausgereift
war und die Geräte noch extrem teuer waren, wurde die MD bald totgesagt. Erst
die Verfahren ATRAC 2 und ATRAC 3 konnten überzeugen. Mit ATRAC 4 wurde sogar
eine wesentlich bessere Qualität als die der CDs erreicht.
Aufbau
der MD
Der prinzipielle
Aufbau einer MO-Disc, ist hier schematisch dargestellt.
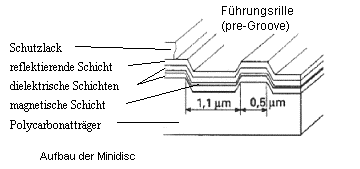
Ein aus Polycarbonat gesprizter
Grundkörper trägt eine bereits vordefinierte Rillenstruktur, der für die
exakte Führung der Optik sorgt. Darauf werden bei der Fertigung mittels
Dünnfilmtechnologie verschiedene Schichten aufgetragen, welche dem Träger
seine magneto-optischen Funktion verleihen.
Die magnetisch wirksame Schicht besteht aus Seltenerdmetallen (Godolinium, Terbium, Dysprosium) bzw. deren Legierungen (z.B.
Terbium-Ferrite-Cobalt bei der MD) und befindet sich zwischen einer
reflektierenden und zwei dielektrischen Schichten. Die magnetische Schicht,
welche ein Wiederbeschreiben überhaupt zulässt, besitzt bei Raumtemperatur
eine extrem hohe Koerzitivfeldstärke, wodurch die Disc selbst gegen starke
Magnetfelder unempfindlich wird.
Die Oberfläche wird zudem mit einem Schutzlack überdeckt und die fertige Disc
als zusätzlichen mechanischen Schutz in ein Kunststoffgehäuse gepackt. Da für
ein Schreiben auf die Disc ein Zugang von beiden Seiten her erforderlich ist,
sind diese Gehäuse mit einem doppelseitigen Schieber ausgerüstet der sich
aufgrund des relativ grossen Schreibkopfes meist über den ganzen Radius
erstreckt.
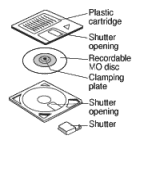
Dieser Aufbau bewährt sich seit
einigen Jahren bei MO-Speichern und erlaubt laut Hersteller das Beschreiben
von über einer Million Zyklen ohne Qulitätsminderung.
Die Zukunft der Minidisc
Lange Zeit hatte das Minidisc-System grosse Schwierigkeiten, sich auf dem Markt
durchzusetzen. Die früheren Versionen von ATRAC (Datenkompression) erreichten
nicht CD-Qualität und viele Experten gaben der MD keine Chance.
Die heutige Version 6 von ATRAC ist punkto Audioqualität mit dem CD-Standard
vergleichbar. Nach der Aufnahme eines CD-Tracks auf eine recordable MD sind
keine hörbaren Unterschiede mehr feststellbar. Das System hat sich auf dem
Markt etabliert und der Name Minidisc ist wohl jedem Musikkonsument ein
Begriff. Besonders die Möglichkeit der digitalen Aufnahme liess die Minidisc
(MD) zu den vorher bekannten Systemen wie Musikkassette (MC), Compact-Disc
(CD) und Digital Audio Tape (DAT) aufsteigen.
Vergleich
MC, CD, MD, DAT
Musikkasette, MC
Als Motivation zur Entwicklung des MD-Systems diente das Verlangen der Konsumenten
für einen Ersatz der Compact-Kassette. Das neue Konzept sollte die Vorteile
der Kassette (Robustheit, Erschütterungsfestigkeit, Mobilität) und die der CD
(bessere Musikqualität, digitale Aufzeichnung) verschmelzen. Diese Ziele
wurden vollständig erfüllt.
Sicherlich wird das MD-System die alte Compact-Kassette in den meisten
Bereichen ablösen, aber wie sieht es mit den digitalen Medien aus?
Compact Disc, CD
Die MD wurde entwickelt um Musikdaten in digitaler Form aufzeichnen zu
können, doch auch die wiederbeschreibbare CD-ROM hat sich in letzter Zeit auf
dem Markt durchgesetzt. Jedoch ist die recordable MD kompatibel zu sämtlichen
MD-Systemen, während die re-writable CD von vielen CD-Playern noch immer
nicht gelesen werden kann.
Die technischen Daten der Minidisc sind deren der CD sehr ähnlich. Der
grösste Unterschied ist die Speicherkapazität der CD mit 650 MB im Vergleich
zur MD mit nur 140 MB. Beide Systeme weisen eine maximale Spieldauer von 74
Minuten auf. Trotz einigen Stimmen, welche behaupten, die Minidisc sei als
CD-Ersatz eingeführt worden, wird sie aufgrund der enormen Verbreitung der CD
diese nicht vom Markt verdrängen können. Vielmehr ist die MD als Ergänzung
zur CD gedacht.
Digital Audio Tape, DAT
Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich die MD im professionellen Bereich
etablieren wird. Das Problem ist, dass die Musikqualität noch nicht den hohen
Standard von DAT- und ADAT-Systemen erreicht hat.
Zukunftsaussichten
Der Produktionspreis einer pre-mastered Minidisc beträgt immer noch
mindestens gleich viel wie der einer CD. Die Beliebtheit der bespielbaren
Minidisc ist jedoch sehr gross und steigt weiter an.
Die Minidisc-Technologie breitet sich auch auf anderen Systeme wie Computer
und digitale Kameras aus. Mit einer Kapazität von 100 Floppydiscs ist die MD
gut als portables Speichermedium oder als Backupspeicher im Computerbereich
geeignet. Die Firmen Syquest und Iomega sind dabei die führenden Anbieter in
diesem Bereich.
Sharp entwickelte eine digitale Kamera, die fähig ist, 2000 Bilder mit einer
Auflösung von 640 x 480 Pixel auf eine einzige MD zu speichern. Die Audio-
und Videosysteme sind sowieso nicht von der 140 MB Standard-MD abhängig, denn
die führenden Entwickler wie Sony, Sharp, Philips und Fujitsu arbeiten
gemeinsam an einer hochkomplizierten Minidisc, die fähig sein wird, 8 GB an
digitalen Videodaten zu speichern. Die Einführung eines solchen System würde
dem heutigen digitalen Videodisc- (DVD) und LaserDisc-Markt echte Konkurrenz
bieten.
Alle portablen Geräte wie Laptops, Palmtop-Organizer und Videospiele könnten
von der Minidisc-Technologie profitieren, da die Systeme immer kleiner und
leichter werden. Auch Hybrid Minidiscs (ein Teil Schreib- und Lesbar, ein
Teil nur Lesbar) könnten in Videospiel-Konsolen Platz finden; Die Software
wird im festen Teil und Spielstände und Einstellungen im beschreibbaren Teil
gespeichert.
Diese Beispiele zeigen, dass die Anwendungsbereiche der Minidisc-Technologie
sehr vielfältig sind. In naher Zukunft wird die Minidisc in erster Linie
versuchen, unsere Wünsche nach leichteren, kleineren, genaueren und
rentableren Systemen zu erfüllen.
|